Sturmflut
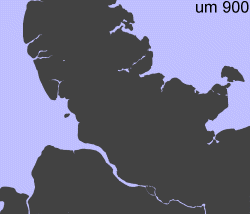
Küstenlinie um 900 n. Chr.
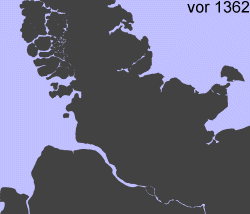
Küstenlinie vor 1362
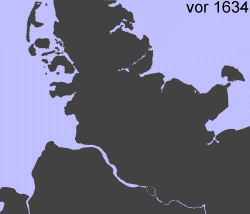
Küstenlinie vor 1634
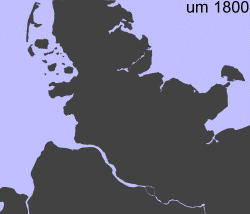
Küstenlinie um 1800
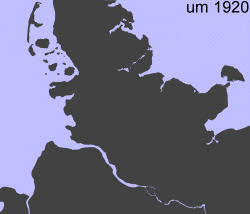
Küstenlinie um 1920
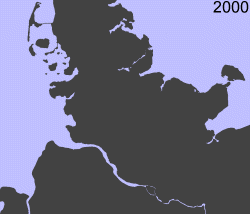
Küstenlinie 2000
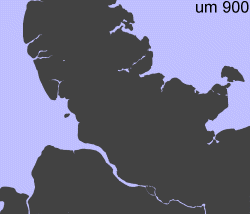
Diese Animation zeigt, wie die Westküste sich seit 900
durch Sturmfluten und Deichbau veränderte
Sturmfluten
begleiten die Geschichte Schleswig-Holsteins. Die erste bezeugte
Sturmflut war die “Julianenflut” vom 17.2. 1164, die vor allem im
heutigen Niedersachen Schäden anrichtete und die Entstehung des
Jadebusens einleitete. Am 16.1.1219 folgte die “Marcellusflut”. Sie
betraf vor allem Westfriesland, doch auch an der Westküste SH ertranken
rund 10.000 Menschen. Nach der “Luciaflut” vom 14.12.1287 (cirka 50 000
Opfer), kam am 16.1.1362 die “2. Marcellusflut”. Sie ging als “Große
Mandränke” in die Geschichte ein. Der Chronist Anton Heimreich (1626
bis 1685) berichtet, daß die stürmische "Westsee" vier Ellen (etwa 2,4
Meter) über die höchsten Deiche gegangen sei, daß die Flut 21
Deichbrüche verursachte, der Ort Rungholt zusammen mit sieben anderen
Kirchspielen in der Edomsharde (![]() Utlande)
unterging und 7.600 Menschen umkamen. Die Chroniken sprechen insgesamt
von 100.000 Toten, eine Zahl, die sicherlich übertrieben ist. Es blieb
die Insel Strand, und es entstanden die ersten
Utlande)
unterging und 7.600 Menschen umkamen. Die Chroniken sprechen insgesamt
von 100.000 Toten, eine Zahl, die sicherlich übertrieben ist. Es blieb
die Insel Strand, und es entstanden die ersten ![]() Halligen. Die Flut durchstieß die
Halligen. Die Flut durchstieß die
![]() Marschen zum Teil bis zum Geestrand (
Marschen zum Teil bis zum Geestrand (![]() Geest). Mit der zweiten Marcellusflut begann in Nordfriesland die Landgewinnung (
Geest). Mit der zweiten Marcellusflut begann in Nordfriesland die Landgewinnung (![]() Marschen/
Marschen/![]() Deichbau)
Weitere Sturmfluten folgten 1373, 1436, 1532, 1615, 1625. Am 11.
Oktober 1634 schließlich die “Burchardiflut”, die “Zweite Große
Mandränke”. Allein in Nordfriesland kamen 9.000 Menschen in den Fluten
um. Die Insel Strand wurde in Nordstrand und Pellworm zerrissen, die
Halligen “Nieland” und “Nübbel” verschwanden. Über 1.300 Häuser, 28
Windmühlen und 50.000 Stück Vieh gingen nach Anton Heimreich durch den
Untergang der Insel verloren. 1717, 1718, 1720 wurde die Küste von
einer Serie von Sturmfluten heimgesucht. Die nächste kam erst 1756. Der
3./4.Februar 1825 sollte zur Jahrhundertflut des 19. Jahrhunderts
werden. In Jütland brach die Nordsee zum Limfjord durch. In den
Herzogtümern blieb sie vor allem als die “Halligflut” in Erinnerung,
weil dort besonders schwere Schäden zu beklagen waren. 1855, 1916,
1936, 1949 sind die Jahreszahlen der nächsten schweren Sturmfluten. Die
“Hollandsturmflut” vom 1.2.1953 wütete vor allem in den Niederlanden,
durchbrach dort die Deiche an 67 Stellen und tötete 2.000 Menschen.
Obwohl Schleswig-Holstein glimpflich davonkam, wurden in ihrer Folge
entlang der Westküste 280 Kilometer Deiche verstärkt. Diese Arbeiten
waren bei weitem nicht vollendet, als am 16./17.Februar 1962 die
“Hamburg-Sturmflut” die Pegel auf 3.25 Meter über MTHW hochtrieb und
allein in der Hansestadt die Deiche an 60 Stellen brachen und das
Hochwasser 315 Menschenleben forderte. In Schleswig-Holstein war zwar
kein Todesopfer zu beklagen, doch von den 560 Kilometern
Festlandsdeichen wurden 70 Kilometer zerstört, 80 erheblich beschädigt
und 120 mußten repariert werden. Die Deiche brachen im Uelvesbüller
Koog auf Eiderstedt und dem unbewohnten Dockkoog vor
Deichbau)
Weitere Sturmfluten folgten 1373, 1436, 1532, 1615, 1625. Am 11.
Oktober 1634 schließlich die “Burchardiflut”, die “Zweite Große
Mandränke”. Allein in Nordfriesland kamen 9.000 Menschen in den Fluten
um. Die Insel Strand wurde in Nordstrand und Pellworm zerrissen, die
Halligen “Nieland” und “Nübbel” verschwanden. Über 1.300 Häuser, 28
Windmühlen und 50.000 Stück Vieh gingen nach Anton Heimreich durch den
Untergang der Insel verloren. 1717, 1718, 1720 wurde die Küste von
einer Serie von Sturmfluten heimgesucht. Die nächste kam erst 1756. Der
3./4.Februar 1825 sollte zur Jahrhundertflut des 19. Jahrhunderts
werden. In Jütland brach die Nordsee zum Limfjord durch. In den
Herzogtümern blieb sie vor allem als die “Halligflut” in Erinnerung,
weil dort besonders schwere Schäden zu beklagen waren. 1855, 1916,
1936, 1949 sind die Jahreszahlen der nächsten schweren Sturmfluten. Die
“Hollandsturmflut” vom 1.2.1953 wütete vor allem in den Niederlanden,
durchbrach dort die Deiche an 67 Stellen und tötete 2.000 Menschen.
Obwohl Schleswig-Holstein glimpflich davonkam, wurden in ihrer Folge
entlang der Westküste 280 Kilometer Deiche verstärkt. Diese Arbeiten
waren bei weitem nicht vollendet, als am 16./17.Februar 1962 die
“Hamburg-Sturmflut” die Pegel auf 3.25 Meter über MTHW hochtrieb und
allein in der Hansestadt die Deiche an 60 Stellen brachen und das
Hochwasser 315 Menschenleben forderte. In Schleswig-Holstein war zwar
kein Todesopfer zu beklagen, doch von den 560 Kilometern
Festlandsdeichen wurden 70 Kilometer zerstört, 80 erheblich beschädigt
und 120 mußten repariert werden. Die Deiche brachen im Uelvesbüller
Koog auf Eiderstedt und dem unbewohnten Dockkoog vor ![]() Husum,
in andere drang Salzwasser ein. Auf Sylt wurden bis zu 16 Meter tief
ins Land Dünen abgetragen. Während die Deiche der Elbmarschen gehalten
hatten, wurden auf Grund des Rückstaus des Hochwasser aber Itzehoe,
Elmshorn und Uetersen überschwemmt, weil die Flußdeiche der Stör nicht
hielten und an Krückau sowie Pinnau ausreichender Deichschutz fehlte.
Als Konsequenz dieser Sturmflut wurde ein Jahr danach der
Husum,
in andere drang Salzwasser ein. Auf Sylt wurden bis zu 16 Meter tief
ins Land Dünen abgetragen. Während die Deiche der Elbmarschen gehalten
hatten, wurden auf Grund des Rückstaus des Hochwasser aber Itzehoe,
Elmshorn und Uetersen überschwemmt, weil die Flußdeiche der Stör nicht
hielten und an Krückau sowie Pinnau ausreichender Deichschutz fehlte.
Als Konsequenz dieser Sturmflut wurde ein Jahr danach der ![]() Generalplan Küstenschutz
für Schleswig-Holstein verabschiedet. Dessen Maßnahmen steckten noch in
den Anfängen, als am 23.2.1967 nach 1949 die “zweite
Niedrigwasser-Orkanflut” mit den höchsten bis dahin gemessenen
Windstärken (bis zu 14 Beaufort, entspricht über140 km/h) eintrat. 1973
folgte eine Serie von Sturmfluten. Übertroffen wurden deren
Wasserstände durch die “Jahrhundertflut” vom 3.1.1976. Sie lief 45
Zentimeter höher als die 1962er Flut auf und brachte die höchsten bis
dahin gemessenen Pegelstände. Der auslösende “Capella-Orkan” war einer
der stärksten der vergangenen 30 Jahre. Er erreichte in Büsum
Windgeschwindigkeiten von zehn Beaufort und Spitzenböen von 13
Beaufort, was 145 Kilometer pro Stunde entspricht. Der ungeheure
Winddruck staute die Wassermassen der Nordsee an den Deichen der Elbe
und an der Westküste Schleswig-Holsteins auf eine bis dahin nicht
erreichte Höhe über Normalnull (NN) an: in Hamburg zeigte der Pegel
6,45 Meter über NN, in Büsum 5,16 m und in Husum 5,66 m. Die Flut war
die große Bewährungsprobe für die Deichverstärkung. Die verbesserten
Deiche und die neuen Sperrwerke bestanden diese Probe. Die Deiche wurde
zwar beschädigt, brachen jedoch nur im Dithmarscher Christianskoog, im
Kehdinger Land und der Haseldorfer Marsch, wo sie noch im alten Zustand
waren. Bei der höchsten Flut seit Menschengedenken kam jedoch kein
Mensch ums Leben. Die Wasserstände der Jahrhundertflut wurden während
der “Nordfrieslandflut” am 24. 11.1981 im Norden des Kreises erneut
übertroffen. Größere Schäden blieben jedoch aus. Vom 26. bis 28.2.1990
folgte die bisher größte bekannte, unmittelbare Folge schwerer Fluten.
Die Küste erlebte in den drei Tagen zwei Sturm-, zwei Orkanfluten und
eine Windflut. In Büsum wurden Windgeschwindigkeiten von 162 km/h
gemessen. Zu Schäden kam es allein beim Deich von Dagebüll sowie an den
Steil- und Dünenküsten. Auf Grund der Klimaentwicklung wird befürchtet,
daß der Wasserstand der Nordsee weiter steigt und Sturmfluten in
Zukunft häufiger auftreten.
Generalplan Küstenschutz
für Schleswig-Holstein verabschiedet. Dessen Maßnahmen steckten noch in
den Anfängen, als am 23.2.1967 nach 1949 die “zweite
Niedrigwasser-Orkanflut” mit den höchsten bis dahin gemessenen
Windstärken (bis zu 14 Beaufort, entspricht über140 km/h) eintrat. 1973
folgte eine Serie von Sturmfluten. Übertroffen wurden deren
Wasserstände durch die “Jahrhundertflut” vom 3.1.1976. Sie lief 45
Zentimeter höher als die 1962er Flut auf und brachte die höchsten bis
dahin gemessenen Pegelstände. Der auslösende “Capella-Orkan” war einer
der stärksten der vergangenen 30 Jahre. Er erreichte in Büsum
Windgeschwindigkeiten von zehn Beaufort und Spitzenböen von 13
Beaufort, was 145 Kilometer pro Stunde entspricht. Der ungeheure
Winddruck staute die Wassermassen der Nordsee an den Deichen der Elbe
und an der Westküste Schleswig-Holsteins auf eine bis dahin nicht
erreichte Höhe über Normalnull (NN) an: in Hamburg zeigte der Pegel
6,45 Meter über NN, in Büsum 5,16 m und in Husum 5,66 m. Die Flut war
die große Bewährungsprobe für die Deichverstärkung. Die verbesserten
Deiche und die neuen Sperrwerke bestanden diese Probe. Die Deiche wurde
zwar beschädigt, brachen jedoch nur im Dithmarscher Christianskoog, im
Kehdinger Land und der Haseldorfer Marsch, wo sie noch im alten Zustand
waren. Bei der höchsten Flut seit Menschengedenken kam jedoch kein
Mensch ums Leben. Die Wasserstände der Jahrhundertflut wurden während
der “Nordfrieslandflut” am 24. 11.1981 im Norden des Kreises erneut
übertroffen. Größere Schäden blieben jedoch aus. Vom 26. bis 28.2.1990
folgte die bisher größte bekannte, unmittelbare Folge schwerer Fluten.
Die Küste erlebte in den drei Tagen zwei Sturm-, zwei Orkanfluten und
eine Windflut. In Büsum wurden Windgeschwindigkeiten von 162 km/h
gemessen. Zu Schäden kam es allein beim Deich von Dagebüll sowie an den
Steil- und Dünenküsten. Auf Grund der Klimaentwicklung wird befürchtet,
daß der Wasserstand der Nordsee weiter steigt und Sturmfluten in
Zukunft häufiger auftreten.
-ju- (0201/0702/0603)
Quellen: Peter Wieland, Küstenfibel, Boyens & Co, 1990 [vergriffen]; Ute Wilhelmsen, Ebbe + Flut, Boyens & Co, 1999 www.buecher-von-boyens.de; Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt und Ortwin Pelc (Hrsg.), Schleswig-Holstein Lexikon, Neumünster, 2000, Wachholtz Verlag, ISBN 3-529-02441-4, Zum Lesen empfohlen (SHLEX)
Bildquelle: Graphik: Henning Höppner; Bild: Archiv Amt Pellworm
